No Logo
Naomi Klein
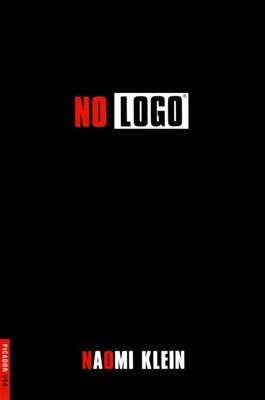
In ihrer scharfsinnigen Studie offenbart Naomi Klein die Machenschaften
multinationaler Konzerne hinter der Fassade bunter Logos. Der von ihr
propagierte Ausweg aus dem Markendiktat ist eine Auflehnung gegen die
Täuschung der Verbraucher, gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen,
Zerstörung der Natur und kulturellen Kahlschlag. Durch ihre
Demystifizierung verlieren die großen, global agierenden Marken an Glanz
und Macht - zum Wohle aller. Marlboro verkauft nicht Zigaretten, sondern
Freiheit; Lewis verkauft nicht Klamotten, sondern einen
unkonventionell-coolen Lebensstil; Nike verkauft Sportsgeist... Es
existiert ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Logo, dem Image einer
Marke und dem Produkt selbst. Die großen Firmen nutzen dies aus. Sie
nutzen die Suche der Menschen nach inneren Werten, um ihre Produkte zu
verkaufen. Im Zeitalter des globalen Kapitalismus verkauft uns die
Produktwerbung all das, was wir im täglichen Leben vermissen:
Selbstverwirklichung, Freundschaft, Kommunikation, Freiheit, Sicherheit,
Glücksgefühle und Spiritualität.
Die 29-jährige Journalistin Naomi
Klein analysiert, was die viel beschworene Globalisierung den Menschen
tatsächlich an Freiheit, Vielfalt und Wohlstand gebracht hat. Das
Ergebnis ihrer Studie ist erschütternd. Denn während Großunternehmen die
freie Wahl der Verbraucher propagieren, beherrschen sie mit ihren
Marken die Medien, den öffentlichen Raum und machen selbst vor Schulen
und Bildungseinrichtungen nicht Halt. Den finanziellen Aufwand, den sie
erbringen müssen, um ihre Marken zu managen, sparen sie bei der
Herstellung der Produkte ein. In Indonesien, China, Mexiko, Vietnam oder
auf den Philippinen produzieren sie in Freihandelszonen, in
ghettoähnlich abgeschirmten "sweatshops", frei von Steuern,
Umweltauflagen und Sozialabgaben so billig, dass Gewinnspannen bis zu
400 Prozent erzielt werden.
Naomi Kleins Buch bringt eine
kulturkritische Auseinandersetzung in Gang. Ihre Kritik richtet sich
nicht nur gegen die Irrwege multinationalen Marketings, sondern ebenso
gegen unsere Gesellschaft, die es versäumt, relevante Fragen rechtzeitig
aufzugreifen und das Feld den Marketingmanagern und Werbestrategen
überlässt. Dieses Versagen bewirkte, dass Gleichheit, Toleranz und
andere ethische Werte plötzlich von Marken wie Nike oder Calvin Klein
besetzt werden konnten und die Diskussion über die Todesstrafe in den
Vereinigten Staaten auf den Werbeplakaten von Benetton stattfand. Naomi
Klein registriert aber auch eine gegenläufige Entwicklung. Im vierten
Teil ihres Buches spürt sie beeindruckende Aktivitäten von Menschen auf,
die es nicht länger hinnehmen, dass die Dritte Welt zur Steigerung des
Komforts in der Ersten Welt missbraucht wird, dass Kinder unter
katastrophalen Arbeitsbedingungen Computer bauen, die sie niemals in
ihrem Leben werden besitzen oder auch nur bedienen können, und dass die
Freiheit des Wortes in kommerzieller Kakophonie untergeht. Die Boykotte
gegen Pepsi, Shell, McDonald's und andere zeigten, dass Konzerne sehr
wohl verletzlich sind. Vor diesem Hintergrund ist Naomi Klein überzeugt:
Je mehr Menschen das hässliche Gesicht hinter der glänzenden Maske des
Logos entdecken, umso mächtiger wird die Welle des Widerstandes gegen
multinationale Konzerne, die den Verbraucher täuschen und die
Globalisierung der Arbeitsplätze zur Ausbeutung missbrauchen.





